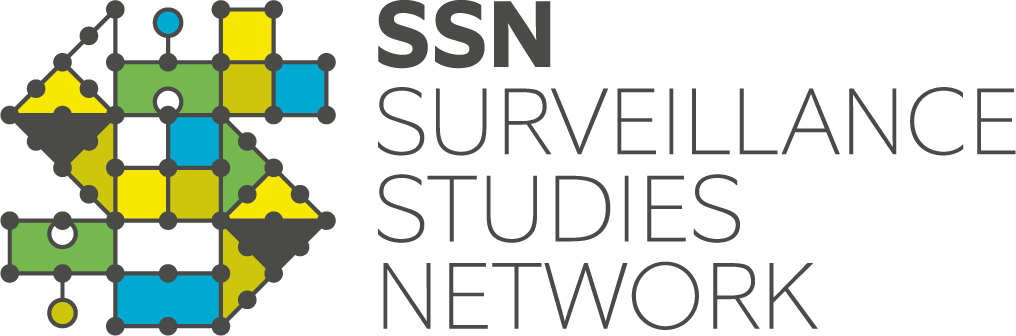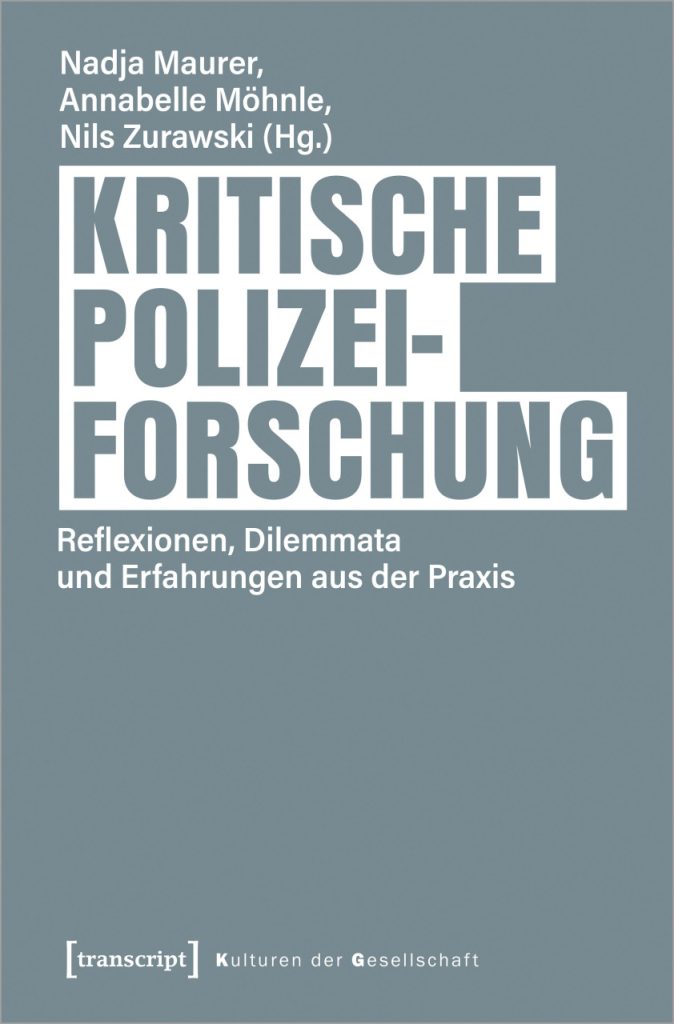Kriminologische Forscher:innen haben in der Regel ein Zeugnisverweigerungsrecht über ihre Gespräche mit Straftäter:innen. Das entschied jetzt das Bundesverfassungsgericht und verwies auf die Wissenschaftsfreiheit.
taz, 20.10.2023, siehe auch tagesschau.de
Nichts sagen zu dürfen oder gar zu müssen, ist das Privileg einiger Berufgruppen, u.a. von Journalist:innen. Und jetzt auch für Wissenschaftler:innen – zumindest vom Prinzip her, wenn auch nicht im Gesetz so festgeschrieben.
Nichts sagen zu müssen, ist auch eine Möglichkeit sich der Überwachung zu entziehen bzw. diese als illegal zu kennzeichnen. Das ist gut so.
Und es sollte nicht nur für Kriminolog:innen gelten, wie im diesem Fall, sondern generell für alle – auch wenn es nicht für alle wichtig ist in ihrer Forschung, aber auch jeden Fall für mehr Leute als nur Kriminolog:innen, die in Gefängnissen forschen und dann auch noch mit dem IS zu tun haben. Es ist generell gut, denn gerade für qualitative Forscher ist es wichtig in prekären Bereichen den Gesprächspartnern diese Zusicherung machen zu können, neben den ohnehin vorgesehenen eigenen Vorkehrungen der Datensicherung und Anonymisierung, die für die Forschung gelten und eingehalten werden sollten.