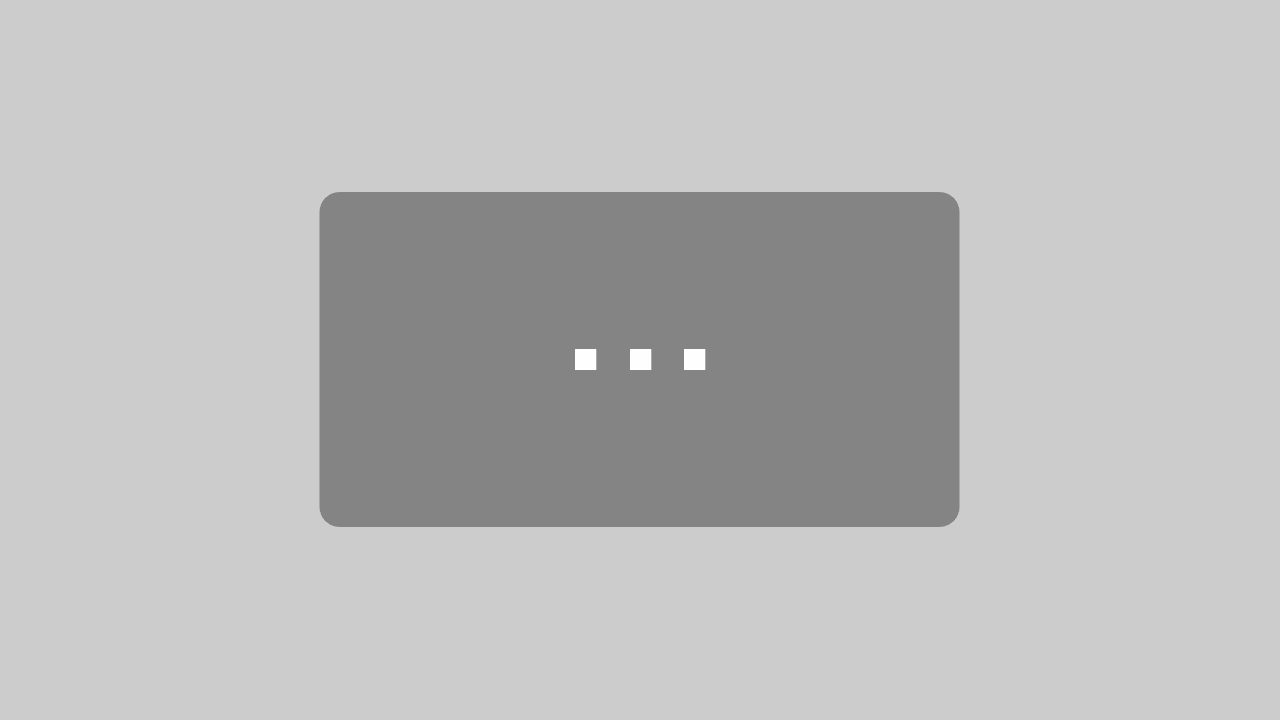Ich hatte immer schon ein Faible für René Girard und seine Theorien der mimetischen Gewalt, des Sündenbocks und seine Analysen. Ja, es ist eher etwas konservativ und auch seine Schüler und die Szene rund um den amerikanischen Literatur-Wissenschaftler und Philosophen Eric Gans sind eher konserverativ, aber eben auch Girard verhaftete Denker. Ihr Zuhause ist das Journal Antropoetics*, zu dem es auch eine Mailingliste gibt, die ich seit 30 Jahren abonniert habe.
Warum erzähle ich das? Auf der Mailingliste gab es einen Hinweis auf folgenden Text: Tech bros don’t get René Girard Luckily, the Popes do. U.a. Peter Thiel hat immer wieder herausgekehrt, wie er von Girard beeinflusst wurde, den er als einen seiner Hero-Denker hervorhebt – Girard hat in Stanford gelehrt, wo Thiel studiert hatte. Ich hatte mich immer schon gewundert und mich gefragt, ob das so richtig passt, gibt es doch eine Art Friedensbotschaft in dessen Texten. Nun gibt es hierauf eine qualifizierte Antwort: Nein, passt nicht.