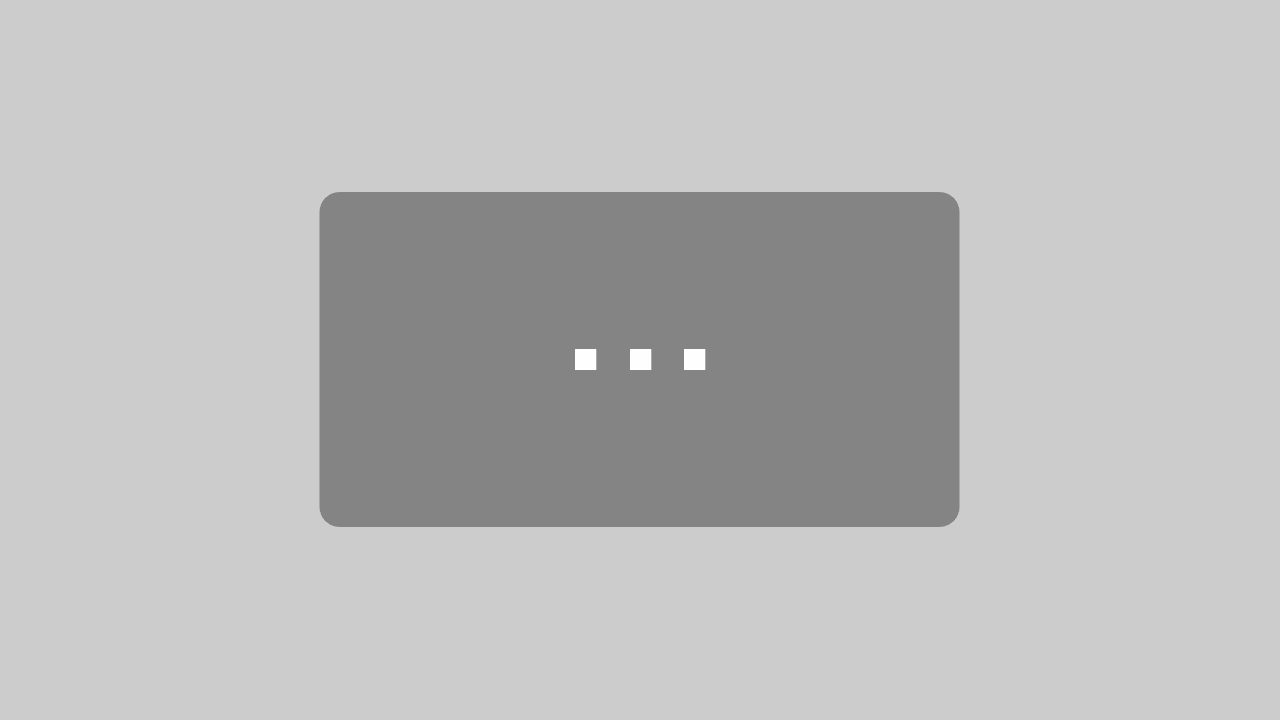If philosopher Will Durant’s assertion that “we are what we repeatedly do” is true, then let’s face it: we are becoming increasingly machine-like through our near-constant interactions with technology.
Ein beängstigender, aber theoretisch auch sehr interessanter Gedanke. Steven Monacelli denkt in Simulacra & Self-Simulation darüber nach, was es bedeutet, wenn wir angeschlossen an die bekannten Plattformen zu, wie er es nennt, “pattern machines” verwandelt werden – “in turn, our digital addictions fuel data collection systems which catalogue, collate, and convert our lives into mathematical probabilities, and, in the process, threaten to transform us from organic, conscious, and autonomous beings into mindless, unconscious, and dependent pattern machines”.