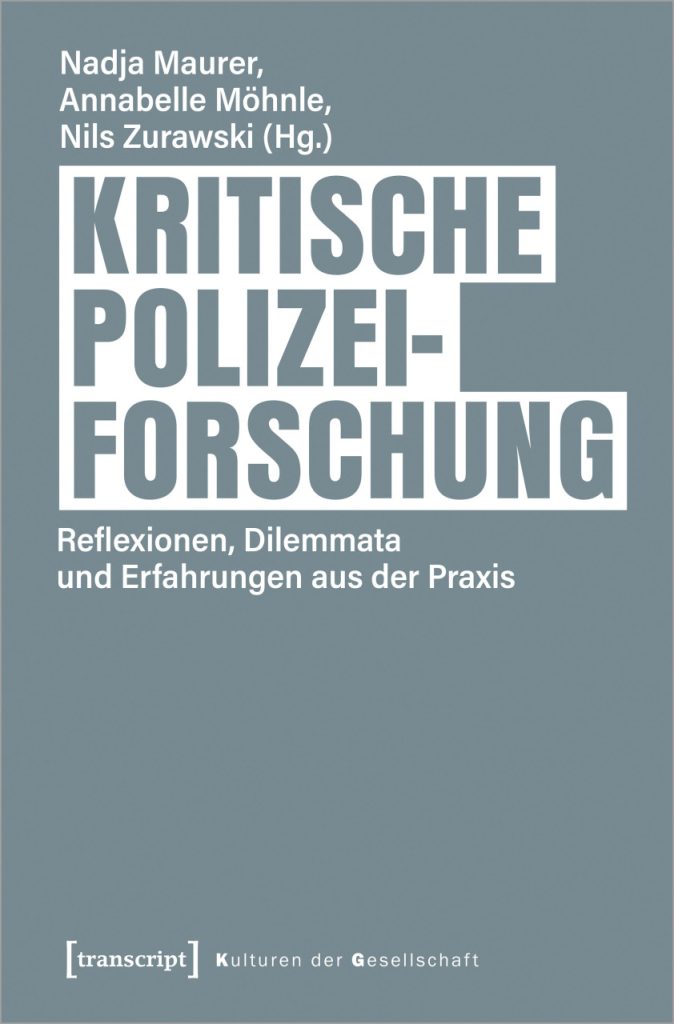Dass Künstliche Intelligenz mehr ist als nur eine Technologie bzw. wie alle Technologien auch Symbol für etwas, Projektionsfläche für Wünsche, ja gar für Utopien einer besseren Welt sind, ist nichts neues, schon gar nicht hier im Blog. Dass es jetzt ein Buch dazu gibt, ist daher umso schöner.
Der geschätzte Kollege Stefan Selke hat mit “Technik als Trost. Verheißungen künstlicher Intelligenz” (transcript, leider nicht open access) eine Analyse veröffentlicht, die einen Blick wert ist. Gerade weil sie jenseits der Technik geht, jenseits der Profit-orientierten Werbesprüche von Politik, Unternehmen und der vielen Blender geht, die damit alles so schön praktisch machen wollen.
Verheißungen über Künstliche Intelligenz (KI) sind spekulative Bedeutungszuschreibungen und Heilsversprechen, die aus KI ein kollektives Tröstungsprojekt machen – so die These von Stefan Selke. In einer Metastudie vergleicht er vier prototypische Zukunftsnarrative und zieht dazu Quellen von Fachtexten bis zu Science-Fiction heran.
Aus der Werbung zum Buch
In diesem Zusammenhang sei dann auch nochmal an das wundervolle Buch von Robert Feustel erinnert: „Am Anfang war die Information. Digitalisierung als Religion”, welches sich hier mit Gewinn als Ergänzung lesen lässt.