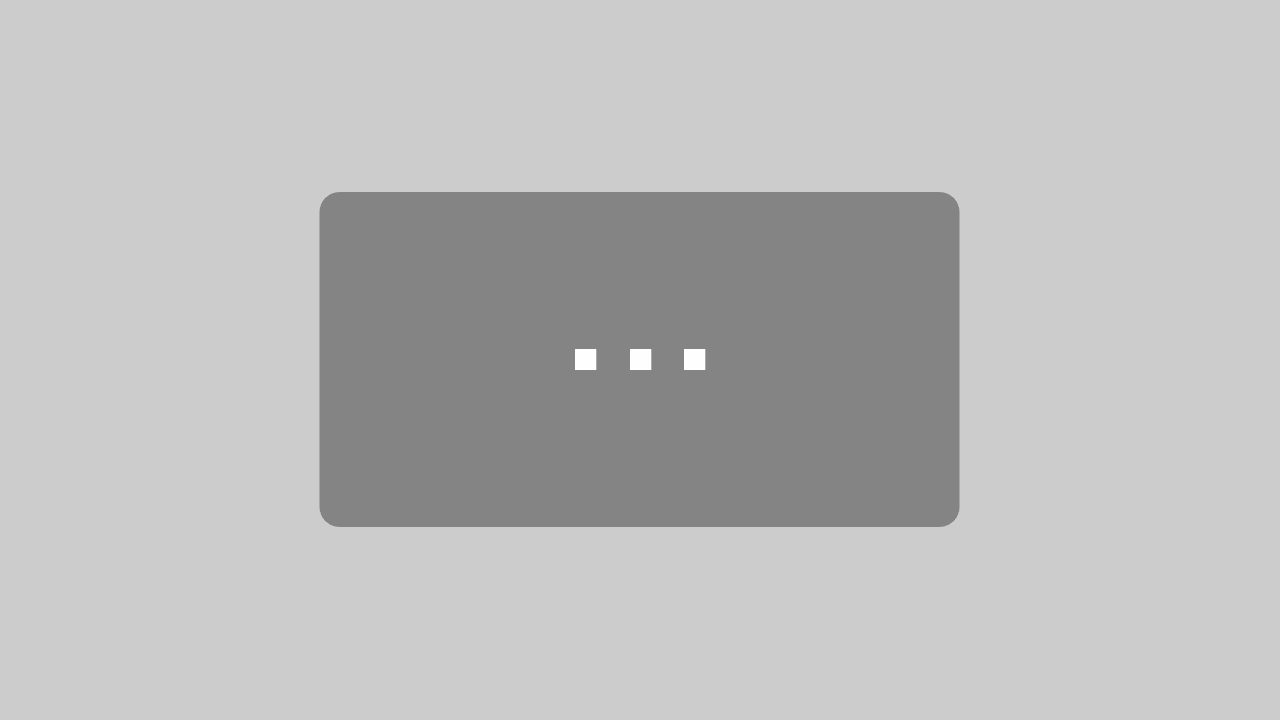Nicole Falkenhayner: Media, Surveillance and Affect. Narrating Feeling States. 2018, Milton Park / New York: Routledge
von Florian Zappe, Berlin
Dem Umstand, dass die Überwachung und vor allem die Bilder, die sie produziert, nicht nur in sicherheitspolitischer, kriminologischer, sozialwissenschaftlicher oder urbanistischer, sondern auch ästhetisch-soziokultureler Hinsicht ein gleichermaßen relevantes wie lohnendes Forschungsfeld bietet, ist in den letzten Jahren von der kulturwissenschaftlich orientierten Strömung der Surveillance Studies in zunehmendem Maße Rechnung getragen worden. Der vorliegende Band von Nicole Falkenhayner reiht sich in diesen Trend ein und untersucht, wie die Ubiquität von Überwachungstechnologien und -bildern das kulturelle Imaginäre einer gegenwärtigen Kontrollgesellschaft (im Deleuzeschen Sinn) sowie die erzählerischen Formen, in denen dieses Imaginäre verhandelt wird, beeinflussen. Dabei spielt eine Analyse der „feeling states“ eine zentrale Rolle, ein Begriff, den die Autorin von Raimond Williams‘ Konzept der „structure of feeling“ ableitet (S. 4) und der mit „Gefühlszustände“ nur unzureichend zu übersetzen ist. Er bezeichnet hier die diskursiv schwer zu fassende, kollektive affektiv-emotionale Erfahrung des Lebens im Kontext einer Überwachungsgesellschaft, die in hohem Maße von medialisierten Überwachungsbildern geprägt wird.
Wenig überraschend dient der Anglistin Falkenhayner die britische Gesellschaft als Fallbeispiel, nicht zuletzt auch, weil diese bekanntermaßen im Hinblick auf die Verbreitung von Videoüberwachung im öffentlichen wie privaten Raum eine (kritisch zu betrachtende und) Vorreiterrolle in Europa eingenommen hat. Als historische Klammer ihrer Untersuchung wählt die Autorin einen Zeitraum von zwanzig Jahren, der konkret durch zwei kriminelle Taten markiert wird, die durch Überwachungs- und Smartphonekameras aufgezeichnet wurden und durch die anschließende mediale Verbreitung tief in das kollektive Gedächtnis der dortigen Öffentlichkeit verankert wurden: Die Entführung und anschließende Ermordung des damals zweijährigen Jamie Bulger durch zwei zehnjährige Jungen im Jahr 2003 und den Fall des Soldaten Lee Rigby, der am 22. May 2013 von militanten Islamisten in London auf offener Straße ermordet wurde. Das selbstformulierte Erkenntnisinteresse der Autorin besteht darin, herauszufinden, „how, in the span of these 20 years, surveillance camera images were used to narrate affecting news stories, stories of experience and memory, and to raise questions of agency in Britain as an example of control societies today”, wobei sie diese Bilder als “the prototypical, meta-symbolic artefact[s] of the imaginary of a contemporary surveillance society” (S. 2) versteht. Das theoretisch-methodische Arsenal, das Falkenhayner zur Erfüllung dieser Mission in Stellung bringt, ist breit. Es reicht, um nur einige zentrale Namen zu nennen, von den affekttheoretischen Ansätzen Sara Ahmeds und Sianne Ngais, über Tia DeNoras „slow sociology“, der von Bruno Latour geprägten, objektorientierten Medientheorie von Nick Couldry und Richard Grusin bis zu verschiedenen narratologischen und bildwissenschaftlichen Konzepten.
Konkret untersucht Falkenhayner nicht nur die soziokulturellen Implikationen der ikonisch gewordenen Überwachungsbilder der realen Verbrechen an Bulger und Rigby (in den Kapiteln 1 und 2). Sie unternimmt auch close readings von künstlerischen Auseinandersetzungen mit dem „meta-symobolischen Artefakt“ (s. o.) des Überwachungsbildes an den Beispielen von Andrea Arnolds Spielfilm Red Road (2006), den Romanen What Was Lost (Catherine O’Flynn, 2007) und Pigeon English (Stephen Kelman, 2011), sowie zweier Werke aus dem Bereich der Videokunst, Jill Magids Evidence Locker (2004) und Manu Lukschs Faceless (2007). Arnolds Film und die beiden Romane sind, wie überzeugend dargelegt wird, paradigmatisch für fiktionales Erzählen in einem gesellschaftlichen Kontext, in dem die Erfahrung der Allgegenwärtig von Videoüberwachung so alltäglich geworden ist, dass sie als quasinatürlich vorausgesetzt wird. Diese „situation of always already being captured“ (S. 86) “die Ambiguität des Verbs “capture” sagt hier viel über diesen kulturellen Zustand aus” wird dadurch zum zentralen strukturierenden Element der Film- bzw. Romanhandlungen, die sich mit der Frage nach der Möglichkeit autonomer individueller Handlungsfähigkeit auseinandersetzen. Während diese Werke in erzählerischer Form die gegenwärtige Überwachungskultur reflektieren, versuchen die Arbeiten von Magid und Luksch mit ihr zu interagieren. Während Luksch, die im Jahr 2004 gemeinsam mit Mukul Patel das Manifesto for CCTV Filmmakers verfasst hat, in ihrem Filmessay
reales, legal appropriiertes Bildmaterial aus Videoüberwachung nutzt, um daraus ein Narrativ zu montieren, inszeniert sich Magid selbst vor den Kameras der Liverpooler Polizei (http://www.jillmagid.net/projects/evidence-locker-2), in dem Versuch, die Hierarchie des Blickregimes wenn schon nicht umzukehren, so durch zu unterlaufen. Falkenhayner verortet gerade in diesem interaktiven Moment, vielleicht mehr noch als in den von ihr diskutieren Romanen, ein Residuum anthropozentrischer Souveränität angesichts einer (überwachungs)technologisch dominierten Welt: „In each case, the artworks, like all the narratives that I have discussed in this project, are the quintessential evidence that humans are […] still here – and still interacting and negotiating ourselves and our feelings with a world of things. As such […] these artworks predicate the fact that we will have the possibility of becoming another kind of human, and of fashioning other kinds of identities in the process“ (S. 153).
Es ist etwas schade, dass die Analyse mit diesem Statement endet und die hier angerissene und höchst aktuelle Frage nach möglichen posthumanistischen Identitäts- und Subjektivitätskonzepten auch im Schlusswort nicht weiter vertieft wird. Ebenso bedauerlich erscheint der exklusive Fokus der Studie auf die Videoüberwachung, der angesichts der vielgestaltigen Affekte, die die noch weitaus totalere Onlineüberwachung von Kommunikation, Bewegung, Konsum- und Sozialverhalten etc. auszulösen vermag, etwas enggefasst und anachronistisch wirkt. Mit ihrer historischen Beschränkung auf die Zeitspanne von 2003 bis 2013 hat sich Nicole Falkenhayner bedauerlicherweise einiger potentieller Anknüpfungspunkte an aktuellere Diskussionen beraubt. Trotzdem ist Media, Surveillance and Affect. Narrating Feeling-States ein insgesamt gelungener Beitrag zur kulturwissenschaftlich orientierten Überwachungsforschung, vor allem, weil es der Autorin gelingt, ein zunächst etwas eklektisch anmutendes Theoriefundament für eine erkenntnisreiche Betrachtung eines kollektiven Unbehagens im Kontext der Überwachungskultur zu Beginn unseres Jahrhunderts fruchtbar zu machen.